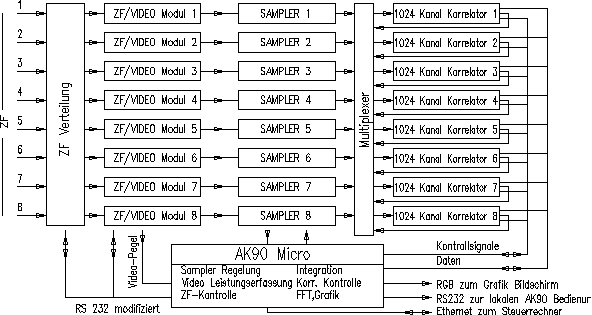
Spectrometer Autokorrelationsspektrometer werden am 100-m-Teleskop für Linienmessungen eingesetzt.
Während einer typischen Messung erfolgt die Datenaufnahme bei den Autokorrelatoren synchron zu den Schaltzuständen am Frontend, gesteuert durch das Austast- und ein Synchronisationssignal, das den Beginn eines neuen Meßzyklus angibt. Meßintervalle sind bei Linienmessung in der Regel länger (500 ms) als bei Kontinuummessungen, die Autokorrelatoren können aber Meßintervalle kürzer als 10 ms noch verarbeiten.
Im Autokorrelator werden die Daten synchron zu den Schaltzuständen über eine Anzahl von Meßzyklen integriert und dann zusammen mit den Ergebnissen der Leistungsmessung für das Gesamtband des gemessenenen Spektrums dem Steuerrechner übergeben. Normalerweise werden die Autokorrelationsfunktionen über mehrere Sekunden im Autokorrelator integriert. Es besteht aber auch die Möglichkeit, auf Kosten der Frequenzauflösung Daten sehr schnell zu übertragen. Beobachter, die solche Anforderungen haben, sollten ihr Meßproblem vorher mit J. Neidhöfer (Effelsberg) oder K. Meyer (Bonn) besprechen.
Der AK90 wurde auf der Basis eines von A. Bos, NFRA, (Netherlands Foundation for Research in Astronomy) entworfenen Chips und einer zugehörigen Korrelatorplatine entwickelt. Dieses Spektrometer kann gleichzeitig bis zu 8 verschiedene Spektren mit je bis zu 1024 spektralen Punkten messen. Die insgesamt 8192 Kanäle können aber auch auf 1, 2 oder 4 Spektren aufgeteilt werden und damit die Auflösung in dem gemessenen Band erhöhen. Bisher sind die Bandbreiten 10, 20,40, 80 und 160 MHz vorhanden, eine Einheit mit je 4 Filtern von 5, 2.5 und 1.25 MHz ist in Vorbereitung. Vor ihrem Einsatz muß aber noch die Frequenzauflösung der Synthesizer (zur Zeit 2 MHz), die das Zwischenfrequenzband in den 8 Kanälen in das Videoband mischen, entsprechend erhöht werden.
Bei diesem Spektrometer erhält man die volle Kanalzahl nur bis zu einer Bandbreite von 20 MHz. Darüberhinaus wird bei jeder Bandbreitenverdopplung die Kanalzahl halbiert. Grund dafür ist die begrenzte Verarbeitungsgeschwindigkeit der Korrelatorchips. Sie wird durch Parallelverarbeitung von Signalen und damit auf Kosten der Kanalzahl erhöht. Bild 11 zeigt die Struktur des neuen Spektrometers
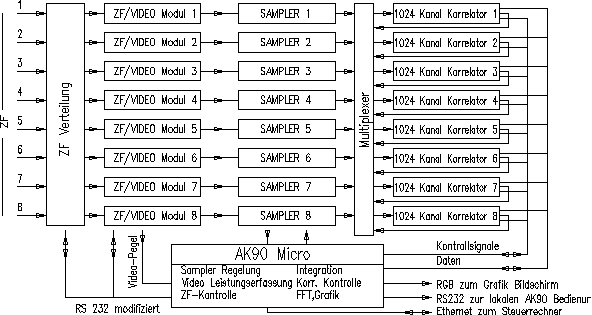
Der Eingangsfrequenzbereich des AK 90 ist 100 - 1100 MHz. Die Synthesizer in den Eingangsmodulen setzen das gewählte Eingangsband in den Videobereich um. Hier befinden sich auch die Detektoren für die Messung der Videoleistung und die Sampler (1 oder 2bit). Der Beobachter kann die Synthesizer in den Modulen unabhängig von einander setzen und so durch Versetzen der Kanäle ein breiteres Band abdecken. Dabei sollte er aber auf Mischprodukte der Synthesizer achten, die trotz der getroffenen Abschirmmaßnahmen im Band auftreten könnten.
Der AK90 kann in mehreren Betriebsarten eingesetzt werden. Sie sind in der unten stehenden Tabelle dargestellt. Die Einrichtung einer Betriebsart, die komplizierte Änderungen im Signalpfad auf und zwischen den Korrelatorplatinen erfordern kann, ist aufwendig und muß sorgfältig getestet werden. Es sind daher bisher nur die Betriebsarten bis Modus 37 sowie Modus 270 implementiert. Die Inbetriebnahme weiterer Betriebsarten ist geplant.
| Modus | ZF-Eingänge
(Eingang Nr.) |
ZF-Module
(Modul Nr.) |
Anzahl
Spektren |
Anzahl
Kanäle |
Bandbreite/
Spektrum |
Block
Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1(1) | 1 | 1 | 8192 | 10/20 MHz | Modus 1 |
| 2 | 2(1,2) | 2(1,5) | 2 | 2x4096 | 10/20 MHz | Modus 2 |
| 3 | 4(1,2,3,4) | 4(1,5,3,7) | 4 | 4x2048 | 10/20 MHz | Modus 3 |
| 4 | 8(1-8) | 8(1-8) | 8 | 8x1024 | 10/20 MHz | Modus 4 |
| 5 | 8(1-8) | 8(1-8) | 8 | 8x512 | 40 MHz | Modus 5/6 |
| 6 | 8(1-8) | 8(1-8) | 8 | 8x256 | 80 MHz | Modus 5/6 |
| 7 | 8(1-8) | 8(1-8) | 8 | 8x128 | 160 MHz | Modus 7 |
| 15 | 1 | 8(1-8) | 8 | 8x512 | 40 MHz | Modus 15/16 |
| 16 | 1 | 8(1-8) | 8 | 8x256 | 80 MHz | Modus 15/16 |
| 17 | 1 | 8(1-8) | 8 | 8x128 | 160 MHz | Modus 17 |
| 25 | 2(1,2) | 8(1/4/6/7,2/3/5/6) | 8 | 2x4x512 | 40 MHz | Modus 25/26 |
| 26 | 2(1,2) | 8(1/4/6/7,2/3/5/6) | 8 | 2x4x256 | 80 MHz | Modus 25/26 |
| 27 | 2(1,2) | 8(1/4/6/7,2/3/5/6) | 8 | 2x4x128 | 160 MHz | Modus 27 |
| 35 | 4(1,2,3,4) | 8(1/6,2/5,3/8,4/7) | 8 | 4x2x512 | 40 MHz | Modus 35/36 |
| 36 | 4(1,2,3,4) | 8(1/6,2/5,3/8,4/7) | 8 | 4x2x256 | 80 MHz | Modus 35/36 |
| 37 | 4(1,2,3,4) | 8(1/6,2/5,3/8,4/7) | 8 | 4x2x128 | 160 MHz | Modus 37 |
| 250* | 2(1,2) | 2(1,5) | 2 | 2x2048 | 40 MHz | Modus 250/260 |
| 260* | 2(1,2) | 2(1,5) | 2 | 2x1024 | 80 MHz | Modus 250/260 |
| 270 | 2(1,2) | 2(1,5) | 2 | 2x512 | 160 MHz | Modus 270 |
| 350* | 4(1,2,3,4) | 4(1,5,3,7) | 4 | 4x1024 | 40 MHz | Modus 350/360 |
| 360* | 4(1,2,3,4) | 4(1,5,3,7) | 4 | 4x512 | 80 MHz | Modus 350/360 |
| 370* | 4(1,2,3,4) | 4(1,5,3,7) | 4 | 4x256 | 160 MHz | Modus 370 |
| © 2007, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn |